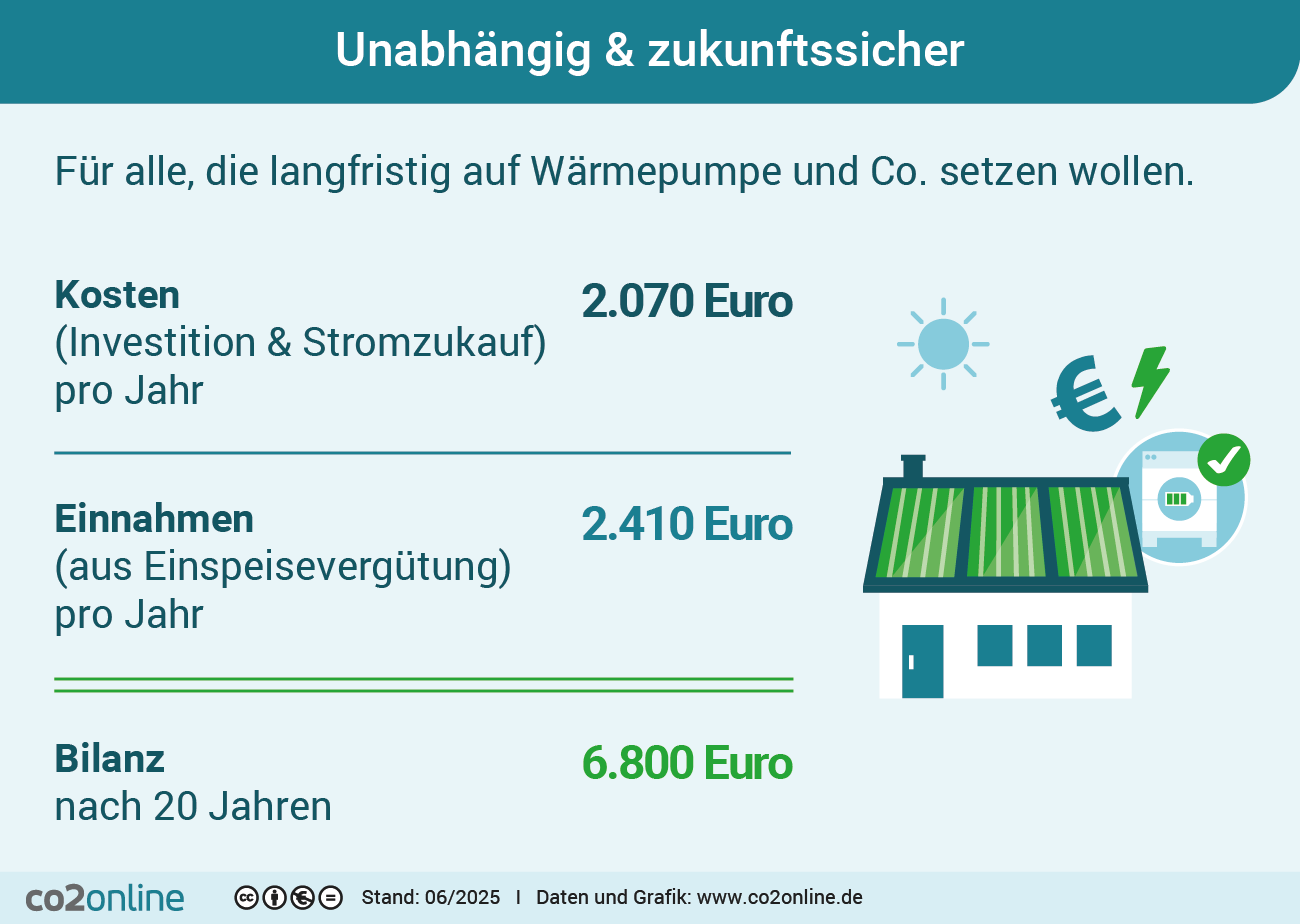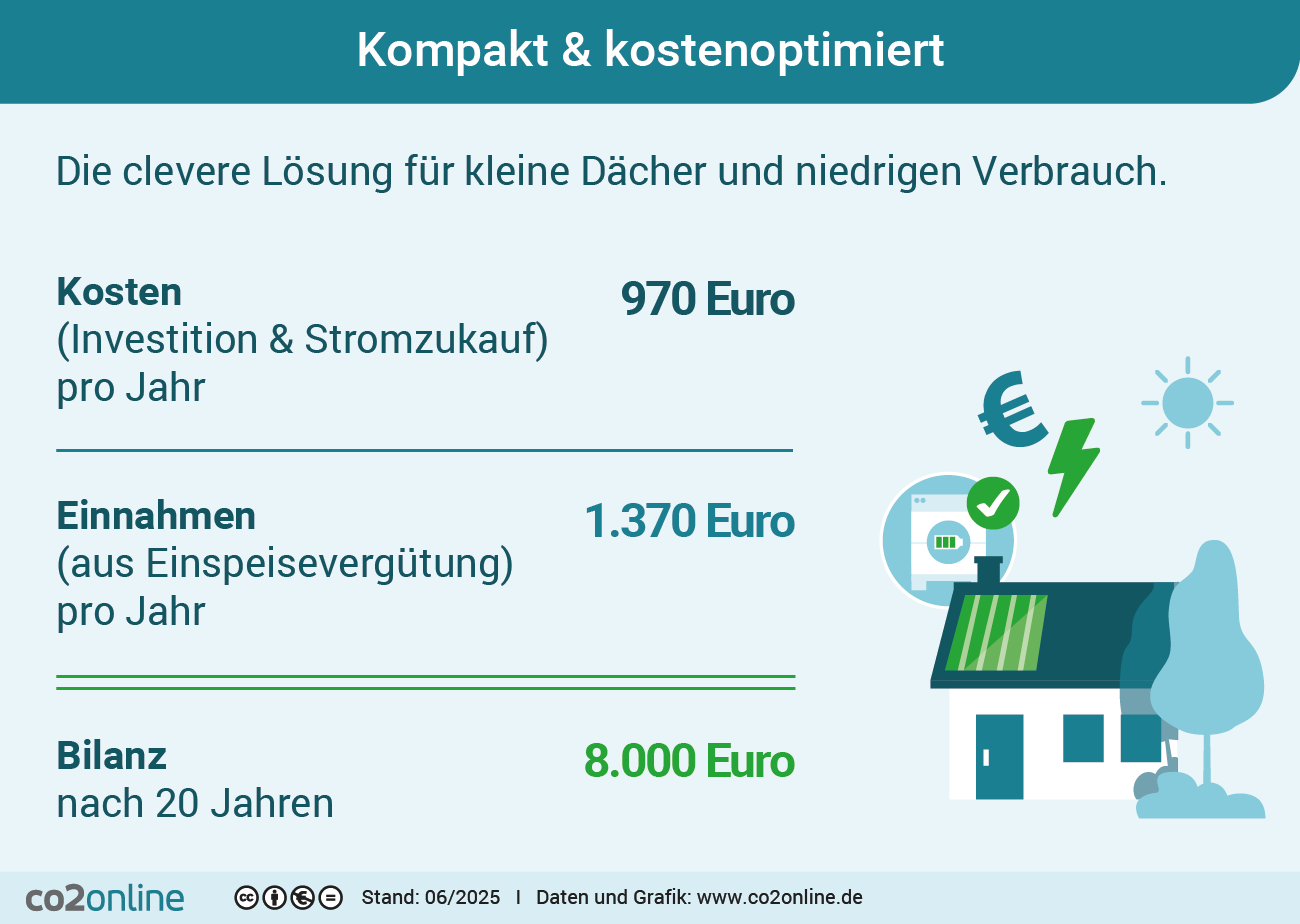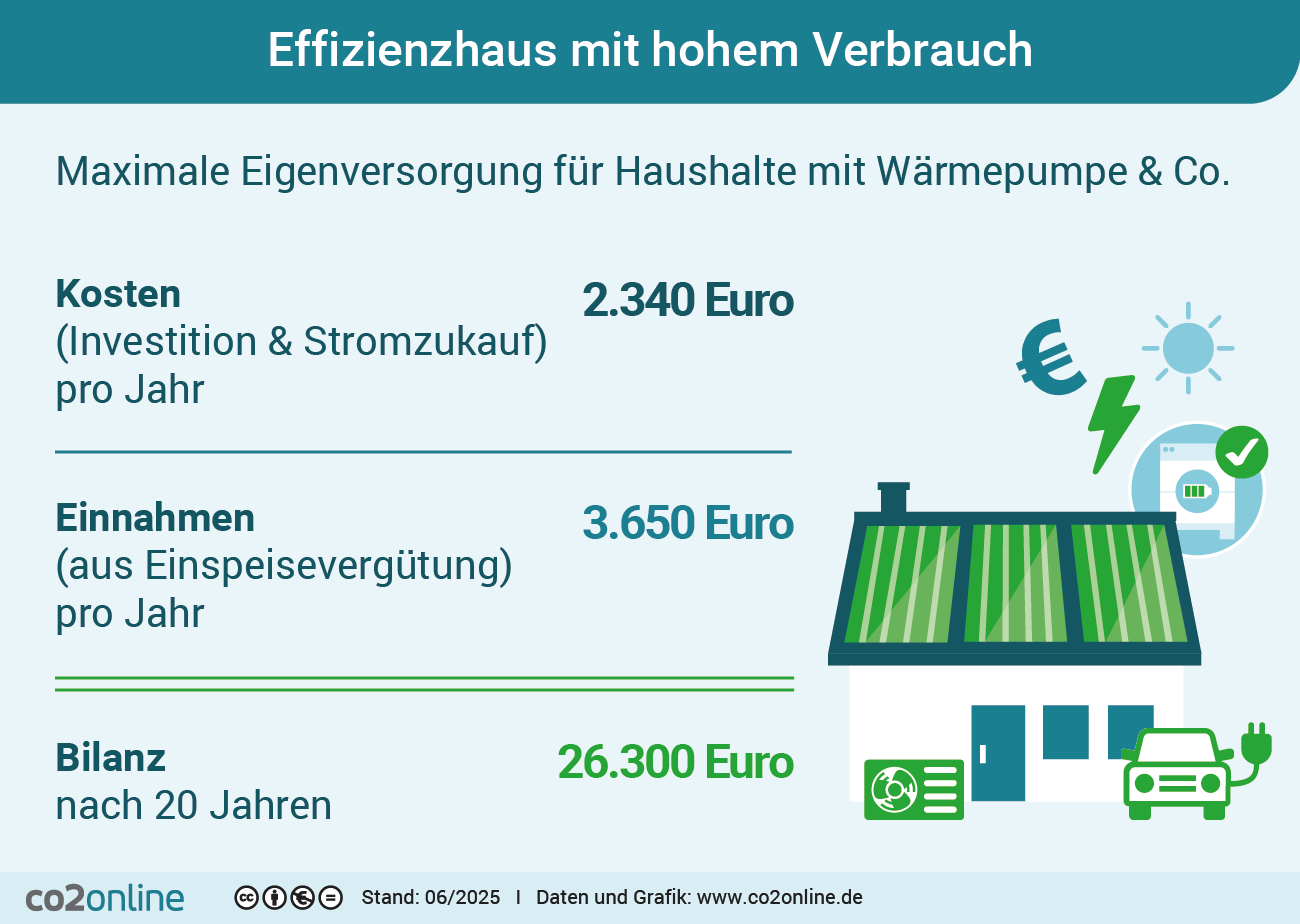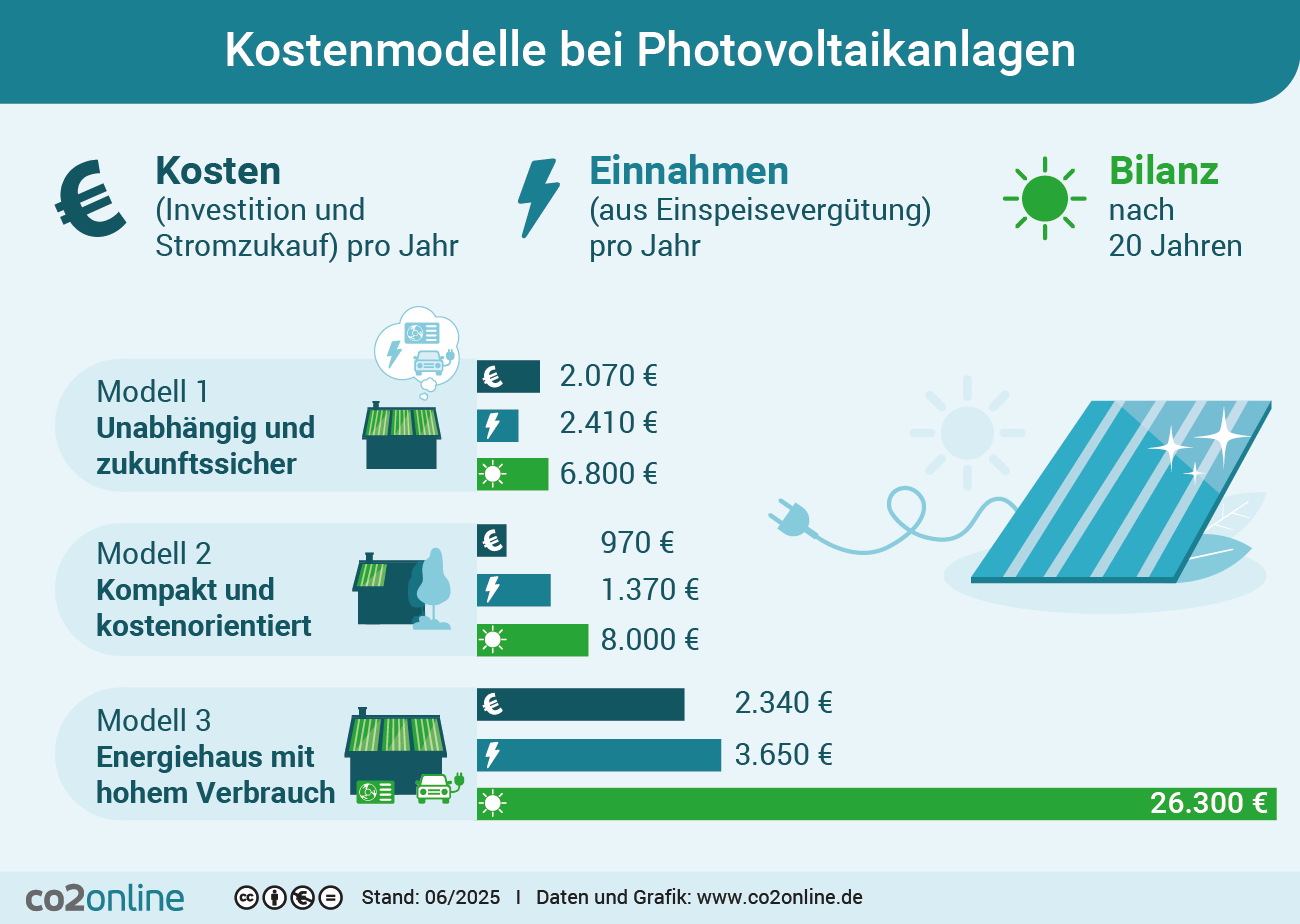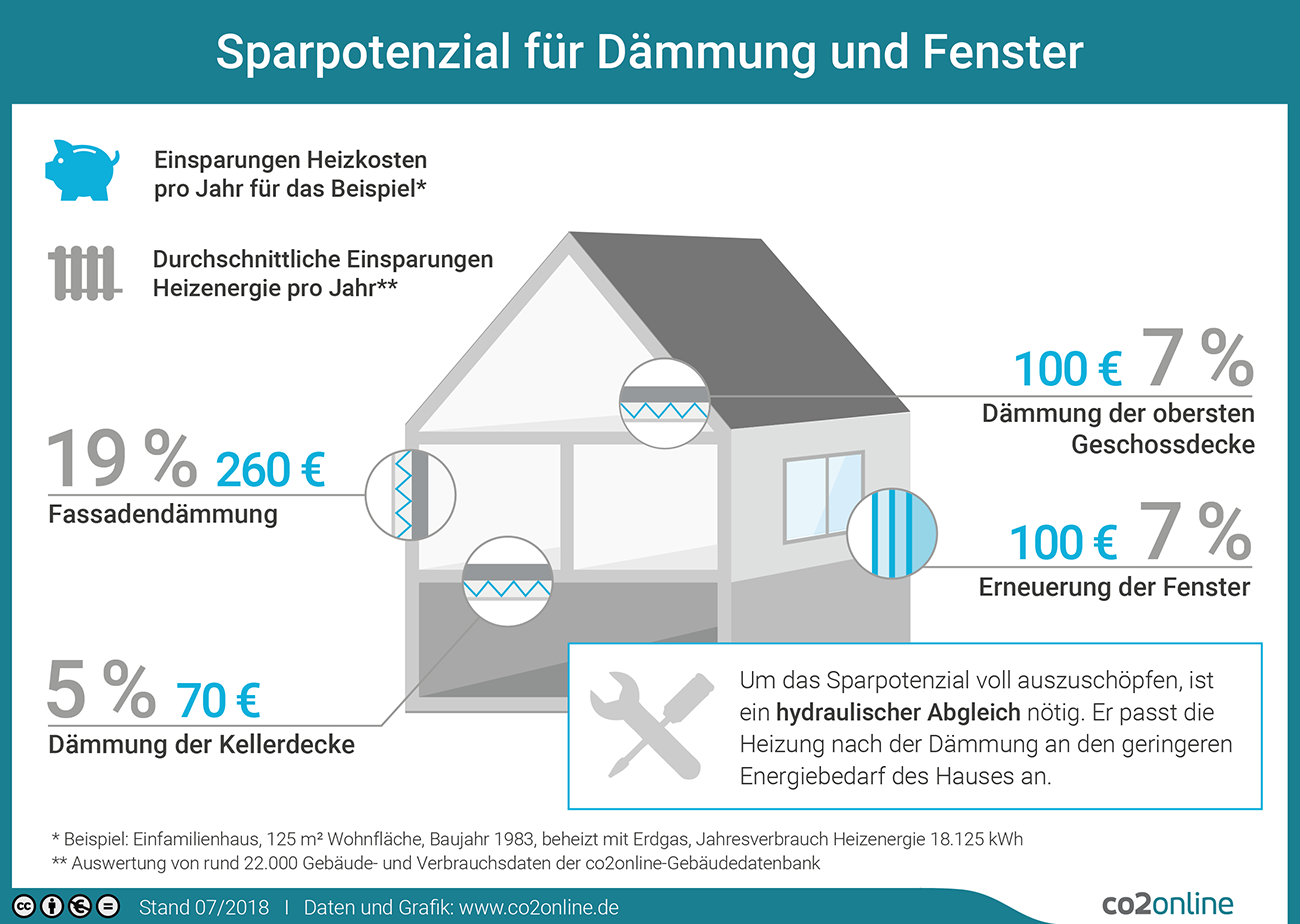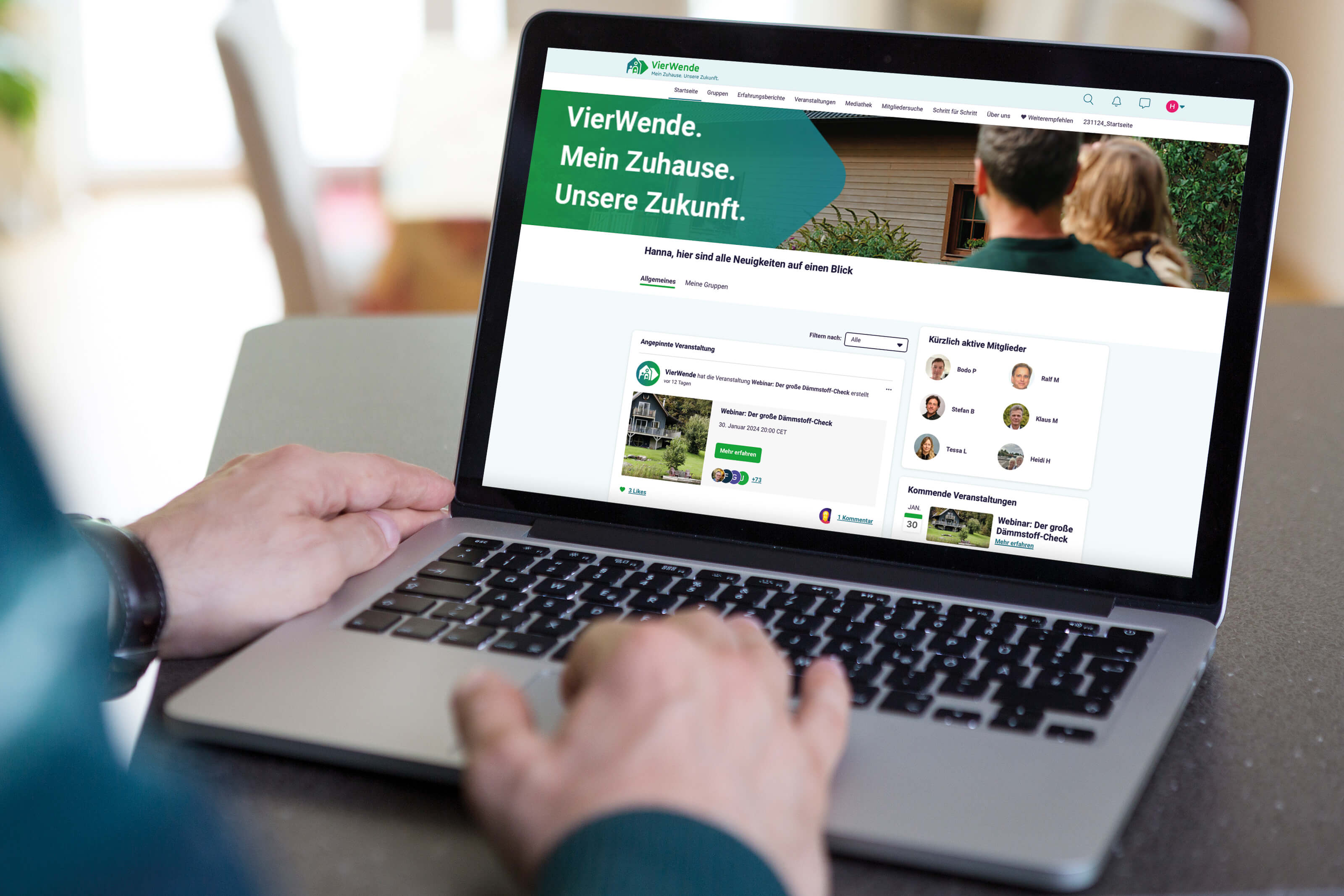Ob und wann sich ein solcher Tarif lohnt, hängt maßgeblich von folgenden Faktoren ab:
- Technische Voraussetzungen in Form von Smart Metern und Smart Meter Gateway. Kurzum: die Möglichkeit, den Stromverbrauch zu erfassen.
- Ausreichend große Abnehmer wie Wärmepumpen und E-Autos.
- Zeitliche Flexibilität der Nutzer*innen. Sie müssen ihr Verhalten gegebenenfalls anpassen.
Für einen klassischen 2-Personen-Haushalt ohne neue technische Messsysteme und E-Auto lohnt sich ein Wechsel zu einem dynamischen Stromtarif kaum. Denn selbst wenn es gelingt, Waschmaschine und Geschirrspüler immer dann anzuschalten, wenn der Strom am günstigsten ist, beträgt die Ersparnis laut Verbraucherzentrale nur etwa 10 Euro. Der Stromverbrauch eines modernen Notebooks fällt ebenfalls kaum ins Gewicht.
Wenn ein großer Stromabnehmer wie ein Elektroauto vorhanden ist und die Bereitschaft besteht, flexibel auf sinkende Strompreise zu reagieren, kann es sich wirtschaftlich lohnen. Die Expert*innen der Verbraucherzentrale gehen hier von einer möglichen Ersparnis von 100 bis 150 Euro pro Jahr aus.
Positive Nebeneffekte für die Zukunft und Umwelt
Ein Nebeneffekt dynamischer Stromtarife ist, dass sich Verbraucher stärker mit ihrem Stromverbrauch auseinandersetzen. Dadurch erkennen sie unabhängig vom Tarif Sparpotenziale und können Strom sparen. Allein durch eine bessere Kenntnis des eigenen Verbrauchs lassen sich die Stromkosten in einem durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt dem aktuellen Stromspiegel zufolge um 36 Prozent senken.
Wer seinen Stromverbrauch zudem dem Tagesverlauf anpasst, sorgt dafür, dass immer mehr sauberer Strom aus Wind-, Wasser- und Sonnenenergie erzeugt und direkt abgenommen wird. Darüber freut sich vor allem das Klima.