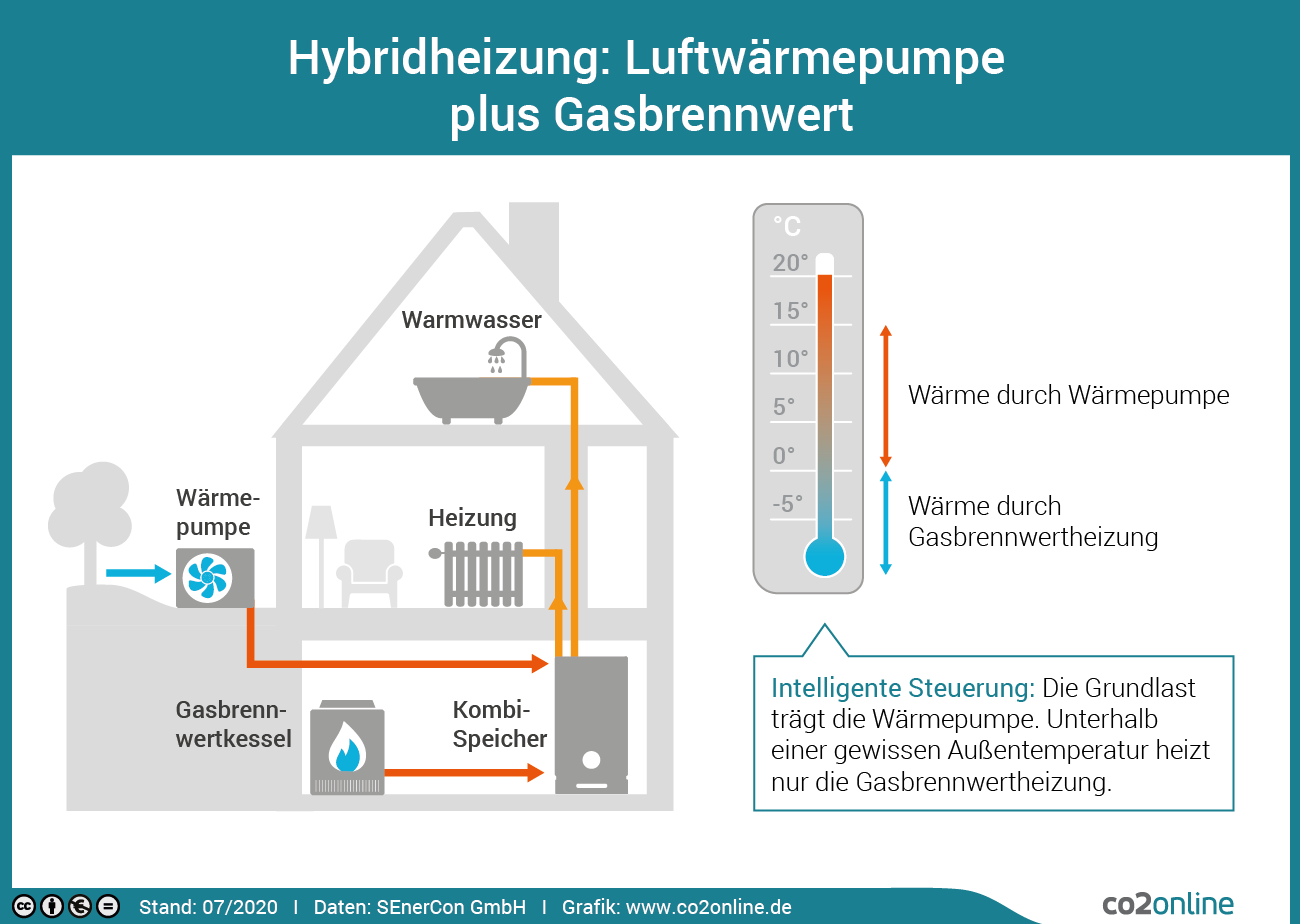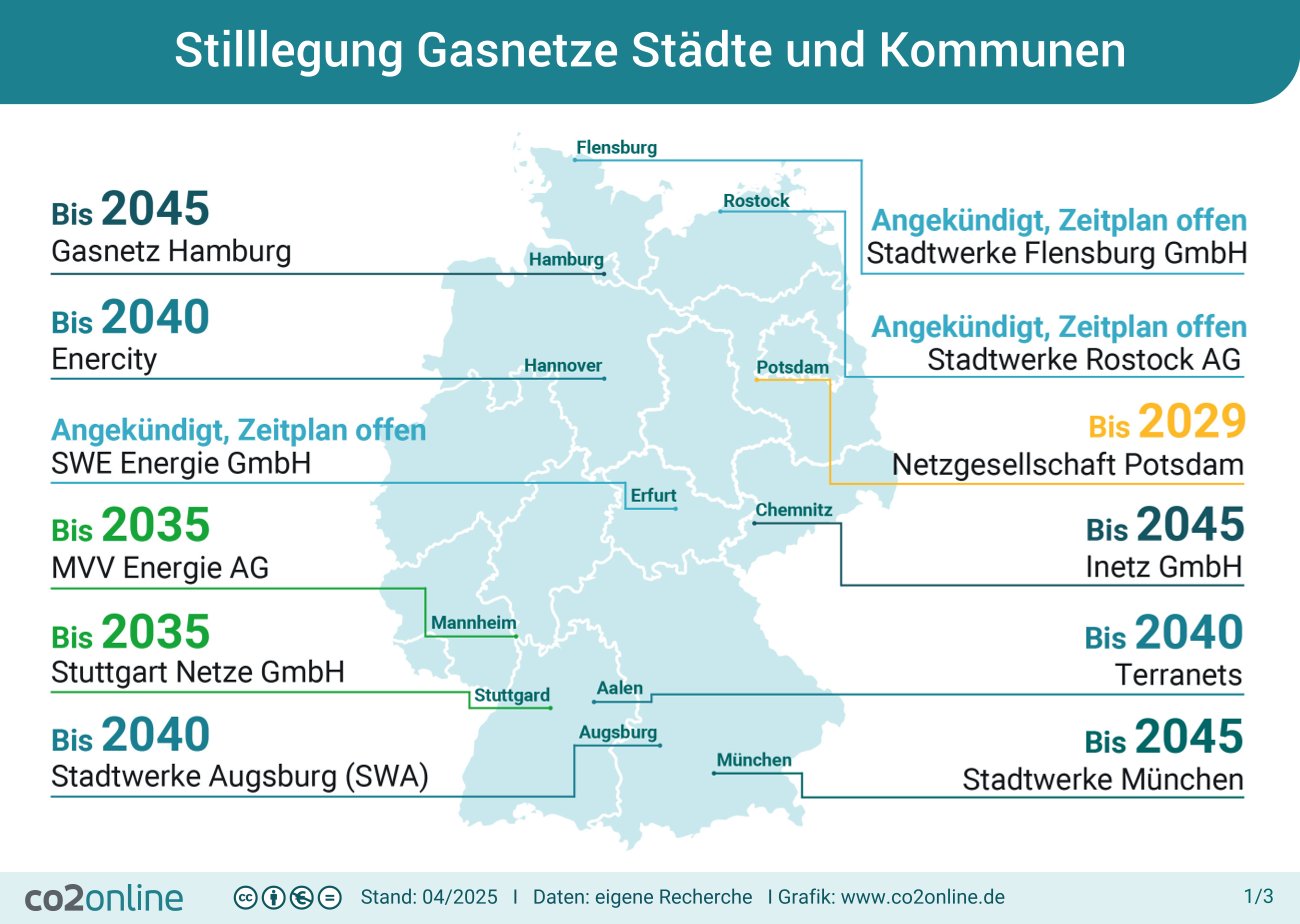Wärmepumpe + PV + Solarthermie
„Sie brauchen dringend eine neue Gastherme“, sagte der Heizungstechniker von Stefan Rahmstorf bei einem Wartungstermin, als er auf die 21 Jahre alte Heizung blickte. Eine neue Gastherme war für den Klimaforscher aber keine Lösung. Er entschied sich für eine Erdwärmepumpe in Kombination mit einer PV- und Solarthermieanlage.
Durch gezielte energetische Sanierungsmaßnahmen und die Nutzung der Erdwärme arbeitet die Wärmepumpe in dem fast 100 Jahre alten Haus äußerst effizient. Im Verlauf eines Jahres wurden aus 7.818 Kilowattstunden elektrischer Energie 37.744 Kilowattstunden thermische Energie für das Heizen erzeugt. Wie der Weg bis dahin war, erzählt Rahmstorf im folgenden Artikel.
Den vollständigen Bericht lesen