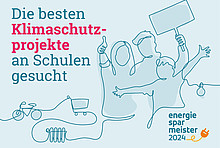Energie sparen. Kosten senken. Klima schützen.
Die unabhängige Beratung für wirksamen Klimaschutz rund um Haus und Wohnung.






Unsere Themen
Energie sparen
Stromrechnung verstehen, Heizenenergieverbrauch analysieren und Maßnahmen finden, mit denen Sie Ihren CO2-Fußabdruck wirksam verringern – legen Sie gleich los!
Mehr erfahrenModernisieren & Bauen
Ermitteln Sie die größten Sparpotenziale rund um Ihr Haus – und erfahren Sie, worauf Sie bei Planung und Durchführung achten sollten.
Mehr erfahrenFördermittel
Unterstützung vom Staat und anderen Fördergeber*innen: Wir zeigen Ihnen den Weg zum passenden Förderprogramm für Ihre Klimaschutzmaßnahme.
Mehr erfahren (c) Westend61 / Tom Schneider
(c) Westend61 / Tom Schneider
Schutz unseres Klimas
Klimaschutz braucht Tempo. Darum fokussieren wir unsere Arbeit auf den Gebäudesektor. Denn hier wird immer noch viel CO2 emittiert. Mit den richtigen Maßnahmen kann das vermieden werden.
Mehr erfahrenUnsere interaktiven Kostenrechner und Datenbanken

HeizCheck
90 % aller Haushalte
640 € Einsparpotenzial
Der HeizCheck prüft den Energieverbrauch des Gebäudes und bewertet die Heizkosten. Mieter*innen und Eigentümer*innen erkennen ihr Sparpotenzial.
Zum HeizCheck
StromCheck
85 % aller Haushalte
320 € Einsparpotenzial
Hoher Stromverbrauch? Der StromCheck bietet Verbraucher*innen Vergleichswerte ähnlicher Haushalte. Das motiviert, zu sparen und die eigenen Kosten zu senken.
Zum StromCheck
WasserCheck
75 % aller Haushalte
90 € Einsparpotenzial
Der WasserCheck zeigt, ob ein Haushalt vergleichsweise viel oder wenig Warmwasser verbraucht. Wer viel verbraucht, erhält Tipps zum Sparen.
Zum WasserCheck
ThermostatCheck
Ob eine Heizung effizient arbeitet, hängt auch von den Thermostatventilen ab. Der ThermostatCheck zeigt, ob es Zeit für einen Wechsel ist. Zum ThermostatCheck

FördermittelCheck
Für jede Sanierung die passende Förderung. Mit dem FördermittelCheck finden Verbraucher*innen das richtige Programm: von Kommune, Land oder Bund.Zum FördermittelCheck

BetriebskostenCheck
Vergleichen Sie Ihre Betriebskosten mit dem bundesweiten Durchschnitt. Der BetriebskostenCheck informiert Mieter*innen und Wohnungseigentümer*innen über Einsparpotenziale.Zum BetriebskostenCheck

Energiesparkonto
Energie-Monitoring für zu Hause: Mit dem Energiesparkonto hat jede/r seine/ihre Verbräuche im Blick – egal ob beim Heizen, bei Strom und Wasser oder dem Auto. Zum Energiesparkonto
Jetzt modernisieren – und in wirksamen Klimaschutz investieren

ModernisierungsCheck
Welche Modernisierung lohnt sich wirklich? Der ModernisierungsCheck informiert über Sparpotenziale und zeigt Hausbesitzern*innen, ob eine Sanierung wirtschaftlich ist.Zum ModernisierungsCheck

WärmepumpenCheck
Finden Sie heraus, ob Ihre Gebäude bereits für eine Wärmepumpe geeignet ist, oder welche Maßnahmen Sie ergreifen sollten.
Zum WärmepumpenCheck

FördermittelCheck
Für jede Sanierung die passende Förderung. Mit dem FördermittelCheck finden Verbraucher*innen das richtige Programm: von Kommune, Land oder Bund.Zum FördermittelCheck

SolardachCheck
Ist das Dach für Photovoltaik geeignet oder nicht? Mit dem SolardachCheck lässt sich der mögliche Ertrag einer Anlage berechnen.
Zum SolardachCheck

PumpenCheck
Ist die Heizungspumpe ein Stromfresser? Der PumpenCheck zeigt, ob Hausbesitzer*innen ihre alte Pumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe tauschen sollten.Zum PumpenCheck

Energiesparkonto
Energie-Monitoring für zu Hause: Mit dem Energiesparkonto hat jede/r seine/ihre Verbräuche im Blick – egal ob beim Heizen, bei Strom und Wasser oder dem Auto. Zum Energiesparkonto
Das zeichnet uns aus
gemeinnützig & unabhängig
20 Jahre Energiespar-Expertise
gemacht von über 40 überzeugten Klimaschützer*innen
Aktuelle Klimaschutz-Nachrichten
Wir beraten Verbraucher*innen für wirksameren Klimaschutz
300.000
Website-Besuche monatlich
120.000
Online-Beratungen monatlich
>150.000
Newsletter-Abonnent*innen
Das Informationsangebot von co2online wird im Rahmen der Online-Klimaschutzberatung gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).